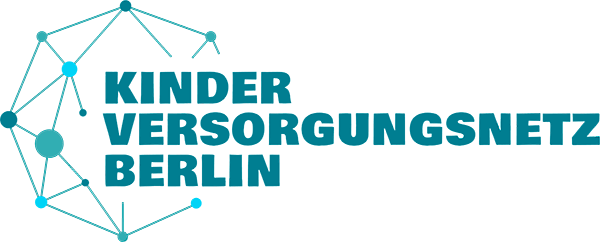Kostenträger für Hilfsmittel: Wer finanziert was?
Je nachdem für welchen Zweck ein Hilfsmittel eingesetzt werden soll, sind unterschiedliche Kostenträger an der Finanzierung beteiligt. Medizinische Hilfsmittel sind Gegenstände, die im Einzelfall benötigt werden, um eine medizinische Behandlung zu unterstützen oder eine Behinderung auszugleichen. Sie werden von der Krankenkasse finanziert. Zum Beispiel Rollstühle. Geräte und Sachmittel, die zur Erleichterung der häuslichen Pflege notwendig sind, werden als Pflegehilfsmittel bezeichnet und von der Pflegekasse finanziert. Kosten für Hilfsmittel können aber auch als Leistung der sozialen Teilhabe oder der Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben über die Eingliederungshilfe übernommen werden. Aber auch die Agentur für Arbeit oder die Rentenversicherungen können für die Finanzierung eines Hilfsmittels zuständig sein.
Medizinische Hilfsmittel
Medizinische Hilfsmittel sind Gegenstände, die zur Sicherung des Behandlungserfolges, zur Vorbeugung oder zum Ausgleich von Behinderungen notwendig sind (SGB V, §33). Dazu zählen z. B. Brillen, Hörgeräte bzw. orthopädische Hilfsmittel wie orthopädische Schuhe oder Rollstühle. Auch technische Produkte wie Blutzuckermessgeräte sind medizinische Hilfsmittel.
Auch bei ärztlicher Verordnung, muss die Krankenkasse die Hilfsmittelversorgung genehmigen. Seit Feburar 2025 entfällt jedoch bei Hilfsmittelversorgungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, deren Verordnungen aus einem SPZ (Sozialpädiatrischen Zentrum) stammen, die Prüfung der Krankenkassen bzw. des Medizinischen Dienstes (MD) auf medizinische Notwendigkeit. Dies ermöglicht eine schnellere Versorgung der Kinder mit Hilfsmitteln und vermeidet unnötige Begutachtungen sowie Widerspruchsverfahren. Selbes gilt auch für Erwachsene mit komplexen Behinderungen, die in einem Medizinischem Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderungen (MZEB) angebunden sind und von selbigem die Verordnungen ausgestellt bekommen.
Die Hilfsmittelversorgung umfasst neben der Bereitstellung auch Änderungen, Instandsetzung und Schulung im Gebrauch. Wählen Versicherte Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen, müssen sie die Mehrkosten und dadurch bedingte höhere Folgekosten selbst tragen (§ 33 Abs. 1 Satz 6 SGB V).
Das Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) listet erstattungsfähige Produkte auf, jedoch entscheidet jede Krankenkasse im Einzelfall über die Erstattung.
Pflegehilfsmittel
Wenn Hilfsmittel dazu dienen, pflegerische Maßnahmen zu erleichtern oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere Lebensführung ermöglichen, so ist keine Verordnung zu Lasten der Krankenkasse auszustellen. In diesem Fall muss sich der Pflegebedürftige oder die ihn betreuende Person selbst an die Pflegekasse wenden und die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln und technischen Hilfen gemäß § 40 SGB XI beantragen. Die Pflegekasse unterscheidet dabei zwischen technischen Pflegehilfsmitteln, wie beispielweise einem Pflegebett oder Lagerungshilfen und zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln, wie zum Beispiel Einmalhandschuhen, Desinfektionsmittel oder Mundschutz.
Wenn ein Pflegegrad vorliegt, besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln in Höhe von bis zu 42 Euro pro Monat. Ein Antrag bei der Pflegekasse reicht aus, damit die Kosten übernommen werden.
Hilfsmittel der Eingliederunghilfe
Die Eingliederungshilfe ist nachrangig nach der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig. Wenn die Krankenkasse nicht zuständig ist oder die Finanzierung eines Hilfsmittels ablehnt, kann dieses bei der Eingliederungshilfe (Teilhabefachdienst) beantragt werden. Vorteil ist, dass hier nicht der enge Hilfsmittelbegriff der gesetzlichen Krankenversicherung gilt. Hilfsmittel im Sinne der Eingliederungshilfe sind alle Gegenstände, die tatsächlich helfen. Der Großbildmonitor oder spezielle Leuchten zum Beispiel. Sie müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn sie zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX), am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX) oder zur sozialen Teilhabe (§ 113 bis 116 SGB IX) notwendig sind. Leistungen der Eingliederungshilfe stehen unter dem Einkommens- und Vermögensvorbehalt (§ 136 SGB IX). Der zuständige Eingliederungshilfeträger wird also eine erweiterte Bedürftigkeitsprüfung vornehmen. Bei Kindern unter 18 Jahren wird auch das Einkommen und Vermögen der Eltern herangezogen.